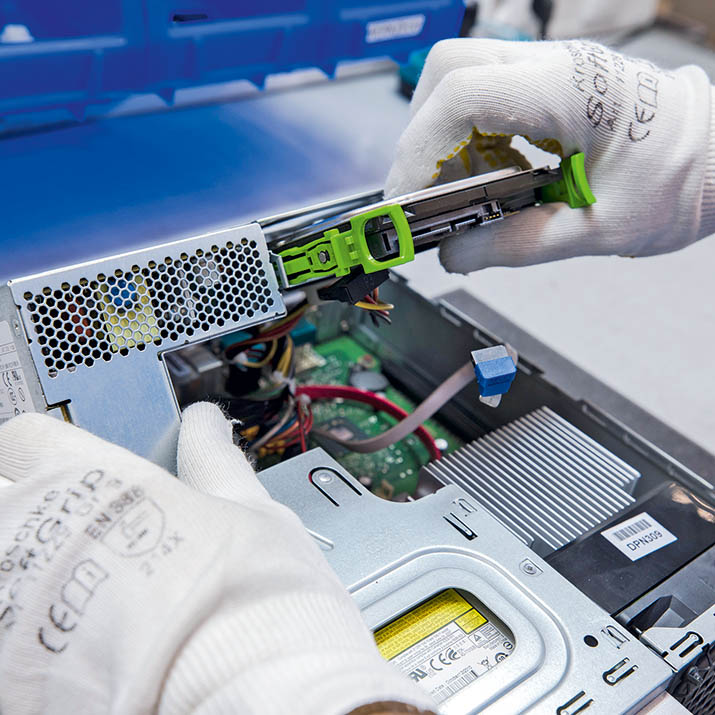Herr Hörmann, Sie sind studierter Geograf, Geschäftsführer und Partner bei der CIMA. Können Sie uns das Unternehmen kurz vorstellen?
Wir sind ein Beratungsunternehmen rund um Stadtplanung und -marketing. Zu unseren Auftraggebern zählen Städte jeder Größe, Kommunen und Regionen. 1988 wurde die CIMA im Rahmen des Modellversuchs „Citymanagement in Bayern“ gegründet. Damals war das ein völlig neuer Begriff, der aus Großbritannien zu uns kam. Dort wurde die Innenstadtentwicklung zu wenig strategisch gesteuert, gleichzeitig boomten Fachmärkte und Einkaufszentren auf der „grünen Wiese“. Die Folge: verwaiste Innenstädte, leerstehende Immobilien. Gegen diese Entwicklung sollten City Manager angehen, die den Blick der Eigentümer- und Unternehmerschaft in die Stadtentwicklungsplanung einbringen und zugleich den öffentlichen Raum inszenieren.
Und das brauchte man Ende der 1980er auch schon in Deutschland?
Ja. Auch bei uns zeigten sich schon damals Tendenzen in diese Richtung. Ein Interventionsprogramm wurde entwickelt und in Bayern vom Wirtschaftsministerium aufs Gleis gestellt. Aber es fehlte eine Stelle, die vermittelte – zwischen den kommunalen Interessen, den Interessen der Eigentümer oder Investoren und denen der Unternehmerschaft, sprich der Händler, Dienstleister, Gastronomen, Kulturtreibenden.
… die Sie mit der CIMA besetzen?
Genau. Weil die Transformation sich beschleunigt, brauchen die Kommunen Fachleute für Stadtentwicklung, um mit mehr Agilität und Tempo zu guten Beschlüssen zu kommen. Dazu gehört, dass wir Meinungsbilder aus der Bevölkerung zusammenfassen, prüfen, was machbar ist, und moderieren. Wir beraten, bündeln, kuratieren und vermitteln, dass möglichst alle an einem Strang ziehen. Ganzheitliche und nachhaltige Stadtentwicklung ist seither unsere Kern-DNA.
Klingt nach einem fordernden Job.
An uns werden tatsächlich hohe Erwartungen gestellt. Wir sind da, um Probleme zu lösen. Für die Eigentümer sollen wir für renditestarke Nutzungen sorgen. Die Bürgerschaft möchte möglichst bald wieder eine lebendige Innenstadt. Und die Politik versucht oft, sich ein bisschen aus dem Wind zu nehmen. Da müssen wir gelegentlich daran erinnern, dass wir gar kein „Entscheider-Mandat“ besitzen. Wir entwickeln machbare Ideen, umsetzen müssen es die Kommunen, Unternehmen und Eigentümer. Trotzdem freue ich mich jeden Morgen auf den vor mir liegenden Arbeitstag. Es wird nie langweilig. Und wenn man nach einiger Zeit in einen Ort kommt, den man beraten hat, und sieht, dass die Innenstadt wieder zu einem belebten, schönen Ort geworden ist, dann ist das wunderbar.
Vielerorts ist es aber noch nicht wieder so weit. Da sieht man viel Leerstand oder Filialen der immer gleichen Ketten. Was ist das dahinterliegende Problem?
Die Leitfunktion der Innenstadt, der Hauptattraktor für Besucherinnen und Besucher, war, historisch betrachtet, immer der Einzelhandel, seit den ersten Stadtgründungen. Markt- und damit Handelsrecht galt nur innerhalb der Mauern. Das blieb lange so: Wer Besorgungen machen wollte, ging in die Stadt. Laut unseren Kundenverhaltensstudien, die wir seit Jahrzehnten erstellen, und unserer „Deutschlandstudie Innenstadt“, die es seit 2022 gibt, war das Einkaufen zu 70, 80 Prozent der Haupt-Impulsgeber für einen Besuch der Innenstadt. Dann kam das Onlineshopping – und diese Kennzahl ist auf 55 Prozent hinuntergerauscht.
Ein Corona-Phänomen?
Nein, das war schon seit den 2010erJahren deutlich merk- und messbar. Die sprunghaften Zuwächse beim Onlineshopping flauten aber nach Corona ab. Jetzt gibt es eine gewisse Plateaubildung bei rund 85 Milliarden Euro, gut 13 Prozent Marktanteil vom Handelsvolumen. In manchen Branchen liegt der Marktanteil aber mittlerweile um die 40 Prozent, zum Beispiel im Bereich Fashion und Accessoires oder Elektro und Consumer Electronics. Bei den Büromaschinen sind es sogar mehr als 70 Prozent. Das bedeutet: Wenn ich weiß, was ich will, muss ich dafür nicht mehr in die Stadt, wenn ich keine Lust oder Zeit habe. Solche „Funktionskäufe“ – einen Milchschäumer, eine neue Jeans – bestelle ich mir einfach nach Hause.
Wir müssen Konsumlaune in den Alltag bringen
Was ist die Folge?
In den Jahrzehnten davor, in denen Kaufkraft und Nachfrage kontinuierlich stiegen, entstanden immer mehr Verkaufsflächen in und um die Städte, viel filialisierter Handel zog ein. Wenn sich die Offlinenachfrage reduziert, haben wir dort zu viel Fläche – die sich in Phänomenen wie dem Kaufhaussterben oder der strukturellen Erosion der B- und C-Lagen manifestiert.
Heißt, um Menschen zurück in die Innenstädte zu locken, braucht es mehr als Shopping.
Richtig. Wir wollen uns dort wohlfühlen. Dann sitzt sogar der Geldbeutel der Deutschen lockerer, die sich ansonsten leicht durch Krisen in ihrem Ausgabeverhalten beeinflussen lassen. Das sieht man auch im Urlaub: Da gönnen wir uns gerne was. Dieses Lebensgefühl – und auch diese Kaufkraft oder besser Konsumlaune – müssen wir in unsere Innenstädte bringen. Der Fokus liegt nicht auf dem Geldausgeben, sondern auf der Frage, ob die Innenstadt ein ganzheitliches Erlebnis bietet. Meine Frau und ich zum Beispiel haben vier Kinder zwischen sieben und 14. Da fragt man sich: Gibt es für unsere sechsköpfige Familie da überhaupt ein Angebot? Gibt es etwas, das wir zusammen erleben, uns anschauen können? Möglichkeiten, wo man sich anschließend mal hinsetzen, eine Kleinigkeit essen kann?
Wie erreicht man dieses bessere Lebensgefühl?
In unserer Innenstadt-Studie zeigt sich, dass die Menschen großen Wert auf grüne und im Sommer auch kühle Zonen zum Verweilen legen: Da muss man gar keine grundsätzliche Klimawandeldebatte führen, das regeln die Bürgerinnen und Bürger selbst mit den Füßen. Außerdem wünschen sie sich einen größeren Mix an Angeboten – von vielseitiger Gastronomie und kulturellen Events über kreative Pop-up-Spaces bis zu Bildungseinrichtungen und Gesundheitsdienstleistungen. Die neuen Nutzungsarten bieten viele Querverbindungen zur Zwischennutzung von leerstehenden Gebäuden. Viele Menschen wünschen sich auch wieder mehr Wohn- und Arbeitsraum in den Innenstädten. Relativ neu ist die messbar stärkere Betonung von Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum. Diesen Punkt müssen wir besonders im Auge behalten.
Kultur wird in den öffentlichen Haushalten dennoch oft stiefmütterlich behandelt …
Wenn ein Stadtkämmerer sagt: Kunst und Kultur können wir uns nicht mehr leisten, das kostet uns ja nur Geld, dann können wir dagegenhalten. Die direkte und indirekte Wertschöpfung ist klar messbar. Eine Landesgartenschau, ein Festival, Kunst- und Kulturevents führen zu hohen Koppelungsintensitäten, die die Aufenthaltsdauern verlängern und damit die Wertschöpfungsketten. Die Stadt gewinnt quantitativ und qualitativ an Attraktivität. Ein gutes Beispiel ist meine Heimatstadt Lindau. Dort haben wir mehrere Kundenherkunftsanalysen durchgeführt und das Ausgabe- und Konsumverhalten gemessen. Seit einiger Zeit gibt es in der Stadt sehr ansprechende Ausstellungen, zum Beispiel Andy Warhol im vergangenen Jahr. Sie haben in dieser kleinen Stadt nachweislich zu völlig neuen Zielgruppenansprachen, mehr Reichweite, auch nach Österreich und in die Schweiz, und einem viel positiveren Ausgabeverhalten geführt.
Durch Events gewinnen Städte und Orte an Attraktivität
Auch die Mobilität ist ein wichtiger Punkt.
Das ist vor allem ein Thema der Mittelstädte. In einer Großstadt wie München – übrigens die Lieblingsinnenstadt der Deutschen – kann man über Verkehrsberuhigung der Altstadt sprechen. Aber hier können die Menschen aus dem Umland mit der S-Bahn anreisen, die Münchnerinnen und Münchner mit der U- oder Trambahn. Das ist in Mittelstädten wie Kempten oder Rosenheim anders. Die haben ein riesiges Einzugsgebiet und keinen kundengerechten ÖPNV in enger Taktung, weil das nicht finanzierbar ist. Die Folge: Besucher kommen mehrheitlich mit dem Auto, selbst wenn das in Zukunft elektrisch ist. An sich kein Problem, wenn es genügend „Auffangstationen“ am Innenstadtrand gibt, wo man das Auto abstellen und den Rest des Weges bequem zu Fuß, mit dem E-Roller oder Leihrad zurücklegen kann.
Welche Erwartungen an den Handel zeigen Ihre Untersuchungen noch?
Die Verbraucher und Verbraucherinnen wünschen sich qualitativ hochwertige Angebote, eine verlässliche und gegliederte Auswahl innerhalb der Branchen, optisch attraktive, gerne inhabergeführte Geschäfte, gepaart mit Leitmarken beziehungsweise Leitfilialisten. Was Lebensmittel und Gastronomie angeht, sind regionale Angebote inzwischen wichtiger als Bioqualität. Märkte im Stadtzentrum haben eine große Attraktivität, auch als Ort, wo man sich trifft, vielleicht nach dem Einkaufen noch einen Happen auf die Hand isst …
Wie lautet Ihre konkrete Empfehlung an den Handel?
Der Handel wird auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen in den Städten. Aber er braucht neue Frequenzpartner. Das kann zum Beispiel die Gastronomie sein. In manchen großen Textilgeschäften gibt es inzwischen von Interior-Designern gestaltete Cafés. Dort hält man sich gerne auf – und sieht auf dem Weg vielleicht ein hübsches Kleidungsstück, das man gerne hätte. Aber ich gehe noch weiter und sage: Auch die Kultur muss Frequenzpartner des Handels sein, ebenso wie Freizeit- und Bildungseinrichtungen. Und man benötigt neue Beratungsqualitäten.
Inwiefern?
Ich brauche keinen Verkäufer, der mir den Zettel an einer Jeans vorliest. Ich möchte, dass mich jemand in meinen Bedürfnissen erkennt, klug nachfragt, mitdenkt und berät. Der mir zur Hose noch ein Hemd zeigt, das gut dazu passt. Diese Art von qualitativ hochwertiger Beratung erfordert natürlich auch eine andere Art von Mitarbeitern – nicht einfach angesichts des massiven Fachkräftemangels.
Wie kann mehr Vernetzung gelingen?
Wir brauchen starke Handels- und Unternehmergemeinschaften, die zusammen mit der Stadt und den Eigentümern an einem Tisch sitzen und sich in die Stadtentwicklung mit einbringen. Wer moderiert das? Gut aufgestellte Wirtschaftsförderungen, proaktive Stadtplanungsämter sowie schlagkräftige Stadt- und Citymarketing-Institutionen. Nebeneinander vor sich hin arbeiten bringt nichts. Lebenswerte Innenstädte schaffen wir nur mit vereinten Kräften.