Sie haben Interesse am LfA Magazin und wollen keine Ausgabe verpassen? Dann registrieren Sie sich jetzt über nachfolgendes Bestellformular und erhalten das Magazin ab sofort kostenlos per Post.
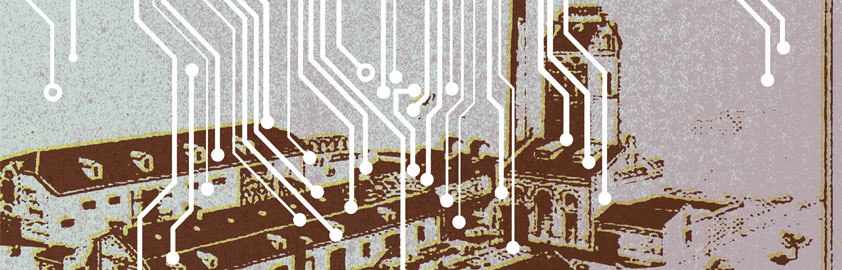
Menschen
Grafik: Thomas Saible;
Fotos: Kunstmuseum Hamburg; fotolia / Mademoiselle Bézier
Interview: Stefan Ruzas
"Die Flamme am Brennen halten"
Tradition bedeutet für Unternehmen oft beides – Chance und Ballast. In jedem Fall ist sie aber Verpflichtung für kommende Generationen. Ein Gespräch mit dem Wirtschaftsforscher Reinhard Prügl
Als Professor ist Reinhard Prügl Inhaber des Lehrstuhls für Innovation, Technologie & Entrepreneurship an der Zeppelin Universität. Mit Tradition kennt er sich aus – auch als wissenschaftlicher Leiter des Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen, kurz FIF. Er forscht dort unter anderem zu der Frage, welche Faktoren die Innovationsfähigkeit von Familienunternehmen über Generationen hinweg beeinflussen und welche Zukunftspläne die Nachfolger haben.
Was ist denn nun wichtiger, Professor Prügl, Tradition oder Zukunft?
Wenn man keine Tradition hat, geht es nur um die Zukunft. Wenn man sie hat, kommt es darauf an, wie man mit ihr umgeht. Viele erfolgreiche Unternehmen in Familienhand verknüpfen beides bewusst miteinander, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Innovationsfähigkeit bei ihnen Tradition hat. Sie schöpfen aus der Vergangenheit die Zuversicht, das Risiko einer größeren Neuerung zu wagen, weil sie mit dem Blick zurück feststellen, dass schon die Vorfahren solche Herausforderungen gemeistert haben.
Wann fängt bei einem Unternehmen überhaupt die Tradition an?
Oft hat das ja mit einer Familiengeschichte zu tun, die über mehrere Generationen wirkt. Schauen Sie sich eine Firma wie Heinz-Glas aus dem oberfränkischen Kleintettau an, die luxuriöse Flakons für Parfums herstellt. Die ist seit 1622 in Familienhand. Auf ihrer Website heißt es in der Rubrik „Unsere Werte & Unternehmenskultur“ ganz bewusst: „Wir wissen, woher wir kommen – und bleiben deshalb auf dem Boden“, und sie zitiert direkt danach den französischen Philosophen Jean Jaurès: „Tradition heißt nicht, Asche verwahren, sondern die Flamme am Brennen halten.“ Das trifft es gut, finde ich.
Hat denn eine jüngere Generation als Nachfolger überhaupt die Möglichkeit, Tradition in ihrem Sinne neu zu deuten?
Ja, ich denke schon. Sie sollte es schrittweise und mit Bedacht, aber gleichzeitig mit Nachdruck machen und das, was da ist, ernst nehmen und darauf aufbauen. Zu radikale Veränderungen könnten nicht nur die eigenen, oft langjährigen Mitarbeiter irritieren, sondern auch die Kunden, Banken und andere wichtige Anspruchsgruppen.
Ihr Institut, das FIF, hat Ende 2017 eine breit angelegte Studie namens „Deutschlands nächste Unternehmergeneration“ präsentiert. Dabei haben Sie die Werte, Einstellungen und Zukunftspläne der 16- bis 40-Jährigen untersucht. Was hat Sie am meisten überrascht?
Wir machen ja diese Studie alle zwei Jahre, dieses Mal mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“. Die nachfolgende Generation ist sich der Herausforderungen, vor denen sie da steht, sehr bewusst, sie hat aber auch richtig Lust drauf. Die Jungen stehen in den Startlöchern, wollen wirklich mit anpacken. Aber nur weniger als jeder dritte von ihnen ist laut unserer Studie mit dem Stand der Digitalisierung im angestammten Unternehmen wirklich zufrieden.
Anpacken heißt ja auch, Verantwortung zu übernehmen. 67 Prozent der von Ihnen Befragten wollen die Führungsnachfolge antreten oder haben es bereits getan. Viel oder wenig?
Ich finde die Zahl sehr ordentlich, angesichts der vielfältigen Karriere-Alternativen, die junge Menschen heute haben. Und unsere Untersuchung zeigt auch: 45 Prozent sehen sich bis zu ihrem 40. Geburtstag als Gründer einer eigenen Firma. Es gibt also auch in dieser nächsten Unternehmergeneration einen großen Drang zu gestalten. Entweder innerhalb der Familie oder aus eigener Kraft. Oft ist es ja auch so, dass potenzielle Nachfolger in Traditionsunternehmen vor ihrem Einstieg erst mal neue Dinge ausprobieren; ein Start-up gründen zum Beispiel, das unter Umständen dann später auch in die Familienfirma eingegliedert werden kann.
Fällt es leichter, ein Traditionsunternehmen zu führen, wenn man von außen kommt?
Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Was zurzeit populärer wird, sind sogenannte Team-Geschäftsführungen; entweder zwei oder mehr Geschwister aus der Familie oder aber zum Beispiel ein Familienmitglied und ein Externer, der häufig auch schon Erfahrung im Unternehmen gesammelt hat. Das ist meist eine sinnvolle Konstellation, gerade in Übergangsphasen von Senior zu Junior, weil der Externe im Idealfall auch eine Art Mediator sein kann.
Lange Tradition ist immer auch ein Ausdruck von andauernder Flexibilität Reinhard Prügl
In welchen Wirtschaftsbereichen ist denn Tradition ein echter Mehrwert – und wo wird sie eher zur Last?
In vielen Branchen vom Maschinenbau bis zur Lebensmittelbranche, aber auch im Luxusbereich wird oft und gerne auf die Herkunftsgeschichte verwiesen. Spannend finde ich, dass auch immer mehr Start-ups Wert auf Langfristigkeit legen, indem sie in ihrem Logo ausweisen, dass es sie „seit 2015“ gibt. Sie signalisieren, dass sie kommen, um zu bleiben.
Als was planen und agieren denn Familienangehörige in der Regel: als Familienmitglied oder als Manager?
Auch das ist sehr verschieden. In der Forschung werden drei Typen unterschieden: Zum einen gibt es die, bei denen sich das stark überlappt und in der Kommunikation auch stark betont wird, dass das Geschäft Familiensache ist. Dann gibt es einen mittleren Typ und schließlich diejenigen, bei denen das Thema Familie in der Kommunikation überhaupt keine Rolle spielt. Oder wussten Sie, dass der Lebensmittelkonzern Mars seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz ist? Und da sind immer noch Angehörige im Management. Grundsätzlich kann man sagen: Traditionsunternehmen erfordern tatsächlich eine gewisse Beidhändigkeit, um auf beiden Ebenen – Firma und Familie – zurechtzukommen. Es erfordert jedenfalls viel klare Kommunikation – die Familie kann als Ressource eine riesige Energiequelle sein, aber auch bremsen, wobei dadurch manchmal auch verhindert wird, dass man zu rasch eine falsche Entscheidung trifft. Das ist eine natürliche Stärke von Betrieben mit Tradition, dass sie aus beiden Systemen schöpfen können.
Tradition und Flexibilität schließen sich nicht aus?
Solange Tradition nicht mit Stagnation verwechselt wird, ganz und gar nicht. Tradition bedeutet ja gerade, dass man über sehr, sehr lange Zeit zeigen konnte, dass man sich den Entwicklungen flexibel stellen kann. Das sind ja, von der industriellen bis zur digitalen Revolution, von der maschinellen Ausstattung bis zur Buchführung, immer wieder wechselnde Rahmenbedingungen, über Generationen hinweg. Oft sind dadurch ganz neue Geschäftsmodelle entstanden oder die Produktion völlig anderer Waren. Lange Tradition ist immer auch ein Ausdruck von andauernder Flexibilität, Innovationskraft und gelungenem unternehmerischem Handeln.
Was braucht es denn, damit ein Generationenwechsel gelingt?
Erst mal handelnde Personen, die den Willen, aber auch die Fähigkeit haben, diesen Übergang zu gestalten. Wir sollten uns dabei nichts vormachen: Die Kommunikation zwischen den Generationen ist oft schwierig und wird manchmal nur durch die Hilfe Dritter richtig möglich. Und das in einer Phase, in der es eigentlich wichtig ist, sich auf der Sachebene über Ziele zu verständigen. Wichtig sind aber auch der eindeutig artikulierte Wille der nachfolgenden Generation und eine entsprechende Ausbildung. Wir als FIF an der Zeppelin Universität bieten dafür beispielsweise eine Reihe von Veranstaltungen und berufsbegleitende Programme wie den eMA FESH (siehe Infokasten) an. Auch, weil der Erfahrungsaustausch der Jungen untereinander elementar wichtig ist.
Laut Ihrer Studie hat nur jeder fünfte potenzielle Nachfolger einen schriftlich festgelegten Plan bezüglich der Rolle und der Verantwortlichkeiten der Seniorgeneration im Unternehmen für die Zeit nach der Übergabe. Gut oder schlecht?
Wir haben auch festgestellt, dass bei rund der Hälfte eine ungeschriebene Vereinbarung existiert, wie die Übergabe ablaufen soll. Wobei ich grundsätzlich ein Freund davon bin, das ab einer gewissen Phase verbindlich zu machen und auch entsprechend zu kommunizieren. Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass die ältere Generation immer wieder sagt: Ja, in zwei Jahren ist es so weit.
Was können Traditionsunternehmen von Start-ups lernen?
Die – oft natürlich notgedrungene – Fokussierung auf ein Zukunftsthema. Und die Bereitschaft, zu experimentieren und aus Fehlern zu lernen. Oder anders formuliert: viele Versuche zu starten, um zu einem Ergebnis zu kommen, frühes Testen von Prototypen, Mut zum Experimentieren. Das sind Dinge, die Start-ups sehr gut beherrschen. Und das in einer Kultur, die ja oft sehr hierarchiefrei ist. Es geht nicht darum, dass Traditionsunternehmen so was einfach nur kopieren, aber es lohnt sich schon, es beispielsweise in einer separaten Einheit mal auszuprobieren. Das Gute ist ja, dass solche Firmen wiederum auch einen langen Atem haben und oft auch eine gewisse Sturheit.
Was können Firmeneigentümer tun, damit ihre Kinder in ihre Fußstapfen treten? Und was sollten sie unbedingt lassen?
Das Wichtigste ist, nicht unnötig Druck zu machen. Es macht keinen Sinn, dass sich schon Kinder verpflichtet fühlen, die Nachfolge anzutreten. Gut ist es aber schon, ein Interesse am Unternehmen zu wecken, die junge Generation beispielsweise mal auf eine Dienstreise mitzunehmen und miteinander über das Geschäft zu reden. Diese Balance zu finden ist schon eine gewisse Kunst. Außerdem sollte sich der Eigentümer nicht zu sehr auf ein Kind fixieren: warum nicht eine Doppellösung mit zwei Geschwistern?
Traditions- und Familienunternehmen dominieren auch heute immer noch auf erstaunliche Weise die deutsche Wirtschaft, wobei das gar nicht so wahrgenommen wird. Warum eigentlich nicht?
Weil sie nicht ständig auf den Busch klopfen und sagen, dass sie die Tollsten und Besten sind. Sie machen einfach ihren Job, sind bodenständig, kümmern sich um ihre Mitarbeiter und die Weiterentwicklung ihres Unternehmens. Sie leisten sehr, sehr wertvolle Arbeit und einen extrem starken Beitrag zu unserer Volkswirtschaft. Wir mit unserem Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen wollen dabei vor allem die junge Generation begleiten und die Bedeutung von Familienunternehmen insgesamt stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Weil nur mit der Innovationskraft dieser Firmen der Wohlstand hierzulande auf dem jetzigen Niveau bleiben kann.


